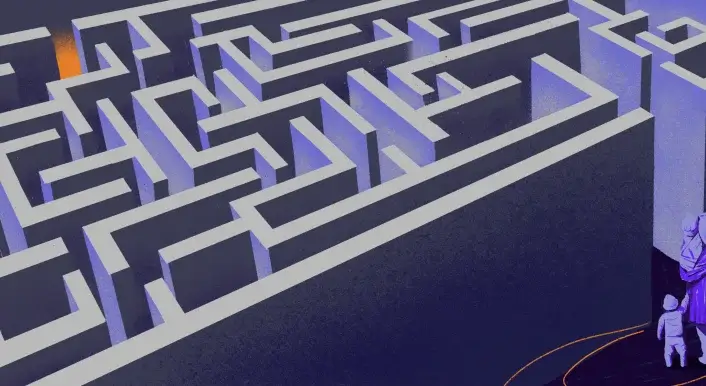Ungesehen – ungeschützt: Frauenhäuser sind nicht für alle zugänglich
Frauen mit Behinderung sind deutlich häufiger von Gewalt betroffen als der Rest der Gesellschaft. Dennoch werden sie in ihrer Not allein gelassen. Warum ist das so?

Warnung: In diesem Beitrag geht es um sexualisierte und häusliche Gewalt.
Schon seit sie ein kleines Kind war, gab es diese Auffälligkeiten, davon ist Mia Schmidt überzeugt.
Sie sprach kaum, trotz eigentlich gutem Wortschatz. Die Angst davor, mit dem Bus zu fahren oder zu telefonieren, war so gross, dass sie Panikattacken auslöste. Sie war blind für die Gefühle von anderen. Auch die eigenen verstand sie irgendwie nicht.
Ihre Eltern hätten sie als aggressiv, als gefühllos bezeichnet, sagt sie heute. Und sie sollen auf Schmidts Verhalten mit Gewalt reagiert haben. Vergass sie etwa, das WC zu spülen, oder verräumte sie ihr Geschirr nicht, sei sie in den Keller gesperrt worden, erinnert sich Schmidt, inzwischen 25-jährig. So lange, bis sie vor Kälte zitterte. Es habe auch Schläge und Würgen gegeben.
Mia Schmidt, die eigentlich anders heisst, schreibt, Verdachtsdiagnosen hätten ihre Eltern nie ernst genommen. Heute ist klar: Sie ist Autistin. Das Asperger-Syndrom ist ihr angeboren. Auf vielen Seiten Text und E-Mails schildert sie CORRECTIV.Schweiz ihre Geschichte. Schreibend fällt es ihr leichter, sich auszudrücken.
Alleine in Not
Als junge Erwachsene verliebte sie sich. Übers Internet, in einen Jungen aus Polen. Vier Jahre seien sie zusammen gewesen, eine Fernbeziehung. Mal besuchte sie ihn, mal er sie. Irgendwann aber fühlte sie sich in der Beziehung nicht mehr sicher.
Mia Schmidt erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner. Immer wieder soll er sie zum Sex gezwungen und sie dabei mitunter auch heimlich gefilmt haben. Im Frühjahr 2023, da sei er gerade zu Besuch in der Schweiz gewesen, soll Schmidt die Beziehung beendet haben. Daraufhin habe er sie vergewaltigt, so schlimm wie noch nie zuvor. Danach, sagt Schmidt, habe sie zwischen den Beinen geblutet.
Hilfesuchend wendet sie sich kurze Zeit später an den Polizeiposten in ihrem Heimatstädtchen im Kanton Solothurn. Dort habe die Polizistin ihr gesagt, sie sei selbst schuld, wenn sie sich nicht trennen würde. Sie sei fortgeschickt worden.
Dass es staatliche Opferhilfestellen gibt, an die man sich in solchen Fällen wenden kann, habe Mia Schmidt nicht gewusst. So blieb sie in ihrer Not alleine.
Immer wieder Gewalt
Schmidt, das zeigt eine Mitgliederumfrage des Vereins Autistinnen.ch, die CORRECTIV.Schweiz exklusiv vorliegt, ist kein Einzelfall: Auf die Frage, ob sie von Stellen wüssten, bei denen sie im Falle von Gewalt Hilfe bekommen könnten, antwortete fast die Hälfte: Keine.
Und Mia Schmidts Geschichte bestätigt, was Studien beziffern: Frauen mit Behinderung sind deutlich häufiger von Gewalt betroffen als der Rest der Gesellschaft. Oft, so erzählt es eine Anwältin, ist das Leben ihrer Mandantinnen von Gewalterfahrungen durchzogen. So wie das von Mia Schmidt.
Gleichzeitig, das zeigt die Recherche von CORRECTIV.Schweiz, werden Frauen mit Behinderung hierzulande nicht ausreichend geschützt. Die Probleme scheinen vielseitig: von Hilfsangeboten, die Betroffene nicht erreichen, bis hin zu Frauenhäusern, die nicht barrierefrei sind.
Zahlreiche Gespräche mit Betroffenen, Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern und Beraterinnen der Opferhilfe offenbaren: Der Schutz von Frauen mit Behinderung hängt vor allem am Engagement Einzelner. Die Kantone tun wenig, um ihre vulnerabelsten Bewohnerinnen zu schützen.
Erleben Sie Gewalt im Alltag?
CORRECTIV.Schweiz will wissen, wo und wie Menschen mit Behinderung Gewalt erleben.
Haben Sie Gewalt erlebt?
Zum Beispiel: Anschreien, Schlagen oder Küssen ohne Erlaubnis.
Sie können uns Ihre Erfahrung hier sagen. Bitte beantworten Sie unsere Fragen.
Wir schützen Ihre Angaben. Niemand ausser uns sieht Ihre Angaben.
Unsere Umfrage ist in Leichter Sprache.
Das St. Galler Frauenhaus ist ein mehrstöckiges Gebäude an einem nicht weiter zu definierenden Ort irgendwo in der Ostschweizer Stadt. Es ist gesäumt von einem Garten, der Platz für einen Ping-Pong-Tisch und eine Rutsche bietet. Auf einem gepflasterten Weg können ihn die Bewohnerinnen durchqueren, ohne den Rasen betreten zu müssen, mit dem Bobby-Car zum Beispiel oder auf einen Rollator gestützt.
Mit einem Schlüssel-Chip öffnet Silvia Vetsch, 64, die ebenerdig abschliessende Türe des Hintereingangs. Hier, erklärt die langjährige Leiterin des Frauenhauses, könnten all diejenigen ins Haus gelangen, die nicht über die Treppe und durch die Sicherheitsschleuse des Haupteinganges kämen. Etwa, weil sie im Rollstuhl sitzen.
Sie tritt ins Untergeschoss des Hauses. Eine Handvoll Kinder kommen um die Ecke gesaust, rennen sie fast um. Um Vetschs kajalumrandete Augen bilden sich Lachfältchen. Sie führt weiter zum Aufzug, mit dem die Bewohnerinnen in alle Stockwerke des Hauses kommen: in den Speiseraum im Erdgeschoss, in die interne Kinderbetreuung ganz oben oder zu den 13 Zimmern, die sich über mehrere Stockwerke verteilen. Letztere sind mit einem ebenerdigen und rollstuhlgängigen Badezimmer und je einem Pflegebett ausgestattet – und so für Frauen und Kinder mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich.
Frauenhäuser: Viele sind nicht zugänglich
Damit ist das Frauenhaus St. Gallen eine Ausnahme. CORRECTIV.Schweiz hat bei allen 23 Frauenhäusern der Schweiz nachgefragt, 13 haben sich zurückgemeldet. Neben St. Gallen ist nur Graubünden vollständig rollstuhlgängig, zwei weitere zumindest teilweise – alle anderen jedoch nicht. Auch Blindenhunde sind in einigen der Häuser nicht gestattet.
Und nicht nur das: Eine Behinderung, egal welcher Natur, kann dazu führen, dass eine Frau, der unmittelbar Gefahr droht, keinen Platz bekommt. So ist es etwa in der Schutzstätte des Kantons Zug. Auf deren Webseite heisst es: Frauen, die aufgrund von Krankheiten oder einer Behinderung fremde Pflege benötigen, können sie nicht aufnehmen.
Frauen mit Behinderung sind zwei- bis dreimal mehr von sexualisierter Gewalt betroffen als der Rest der Gesellschaft, wie eine Studie aus Deutschland zeigt. Repräsentative Erhebungen für die Schweiz gibt es nicht, allerdings gehen Forschende hierzulande von ähnlichen Zahlen aus.
In einer Umfrage der Hochschule für Heilpädagogik zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen Frauen sowie intergeschlechtlichen, nichtbinären, trans- und agender Personen (FINTAs) in der Deutschschweiz gaben über die Hälfte der Befragten an, bereits ungewollte sexualisierte Handlungen unter Zwang, Druck oder Angst erlebt zu haben.
Frauen mit Behinderung: zwei- bis dreimal mehr betroffen
Und auch die Mitgliederbefragung des Vereins Autistinnen.ch ergab, dass fast 70 Prozent der Mitglieder im häuslichen Kontext gewaltvolles Verhalten erlebt haben, darunter Schläge, Herabsetzungen und sexualisierte Gewalt. Die meisten der rund 120 Befragten sind Frauen.
Silvia Vetsch, die das Frauenhaus St. Gallen seit einem Jahrzehnt leitet, nimmt schon immer Frauen und Kinder mit Behinderung auf. Die Bedingung sei: Sie müsse mit den Personen arbeiten können. Auch eine krebskranke Frau oder ein Kind mit schwerer körperlicher Behinderung habe sie schon beherbergt – und die Spitex zur Pflege hinzugezogen. Seit dem Umzug vor einem Jahr könne Vetsch nun auch Frauen mit Mobilitätseinschränkungen aufnehmen. Die habe sie früher ablehnen müssen.
Allerdings stiessen sie immer wieder an Grenzen: Suchtkranke Frauen, die die Sicherheit der anderen Frauen aufgrund ihres Verhaltens gefährdeten, mussten wieder gehen. Vetsch betont: Frauen und Kinder mit erhöhtem Pflegebedarf aufzunehmen, sei eine Entscheidung des Teams, da es fast immer zu Lasten der Mitarbeiterinnen gehe. Sie trügen die Zusatzbelastung und das Risiko.
Dass das Frauenhaus St. Gallen grundsätzlich jede Frau aufnehmen kann, liegt an der guten Aufstellung ihres Teams, sagt Vetsch. Und daran, dass es finanziell deutlich besser dasteht als die anderen Schweizer Häuser.
Vielen Frauenhäusern fehlt Geld
Seit den 90er Jahren gilt zwischen dem Frauenhaus und dem Kanton St. Gallen eine Leistungsvereinbarung: Neben den Beiträgen der Sozial- und Opferhilfe, die das Haus pro untergebrachter Frau erhält, leisten die Kantone St. Gallen, beider Appenzell und Glarus einen jährlichen Sockelbetrag, der die Kosten des Hauses mitträgt.
Da die benachbarten Kantone keine eigenen Frauenhäuser betreiben, können die Frauen von dort in St. Gallen Unterschlupf suchen.
Deshalb, so Vetsch, könne man sich in St. Gallen mehr leisten: das neue, barrierefreie Haus. Extra Personal, das im Notfall – also auch, wenn eine Frau mit Behinderung mehr Betreuung benötigt – einspringen kann. Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen, die in Frauenhäusern typischerweise sozialpädagogische und keine psychotherapeutischen oder pflegerischen Hintergründe haben.
Auch für die Finanzierung gilt: St. Gallen ist eine Ausnahme.
Fehlende Unterstützung der Kantone
Vielerorts kämpfen die Frauenhäuser, die meist in Form von Stiftungen oder Vereinen organisiert sind, ums finanzielle Überleben. So wie im Kanton Zug. Das dortige Frauenhaus erhält pro untergebrachter Frau die entsprechenden Tagessätze der Sozial- und Opferhilfe. Die reichen jedoch nicht, um die Kosten zu decken.
Der Kanton leistet seit 2024 zusätzlich jährlich einen Beitrag von 30’000 Franken aus dem Lotteriefonds – trotzdem ist das Haus weiterhin auf die Spenden einer privaten Stiftung angewiesen, um seine Ausgaben zu tragen.
Zudem finden auch Frauen aus den umliegenden Kantonen, die keine eigenen Frauenhäuser haben, Schutz in Zug. Zum Beispiel aus dem Kanton Schwyz. Dieser unterstützt die Zuger Herberge jedoch nicht.
Für die Realität des kleinen Hauses, das sich wie viele Frauenhäuser im Land in alten Bauten befindet und aus zwei Wohnungen und acht Zimmern besteht, bedeutet das: Schon das Zusammenleben von Frauen und Kindern ohne Behinderung ist je nach Belegung eng. Geld für einen Umbau oder für Fachpersonal, beispielsweise eine Pflegefachperson, gibt es nicht. Nur: Ohne diese Mittel wird es kaum möglich sein, Frauen mit Behinderung umfassend Schutz zu bieten.
Ähnlich geht es Maria Mondaca, die das einzige Mädchenhaus der Schweiz leitet. 2024, so schätzt sie, konnte sie ein Drittel der Mädchen mit Behinderung, die einen Platz anfragten, nicht aufnehmen. Darunter waren Mädchen mit starken kognitiven und psychischen Einschränkungen. Wie in Zug fehlt es in Zürich an Fachpersonal, Zeit und Geld für einen Umbau.
Kein Platz für Mädchen in Not
Die Tatsache, dass einige Kantone die hiesigen Frauenhäuser mit Leistungsvereinbarungen unterstützen und andere nicht, zeigt: Der Schutz von Frauen, ob mit oder ohne Behinderung, ist abhängig vom politischen Willen.
Aus der Zuger Sicherheitsdirektion heisst es auf Anfrage, dass derzeit im Rahmen der laufenden Polizeigesetzrevision an einer Gesetzesgrundlage gearbeitet wird, die es künftig ermöglichen soll, Leistungsvereinbarungen mit Frauenhäusern abzuschliessen. Die gebe es bisher nämlich nicht.
In Schwyz hat der Regierungsrat im Oktober dieses Jahres seine Zustimmung für einen Vorstoss gegeben, der eine Grundlage zur Finanzierung von Schutzunterkünften in anderen Kantonen schaffen soll. Offen ist, ob auch der Kantonsrat die Notwendigkeit einer solchen Regelung erkennt.
Gleichzeitig, davon sind Leiterinnen mehrerer Frauenhäuser überzeugt, kämen viele Betroffene mit Behinderung gar nicht erst zu ihnen. Auch mehrere Mitarbeiterinnen der Opferhilfe, mit denen CORRECTIV.Schweiz gesprochen hat, bestätigen das. Gewaltbetroffene Menschen mit Behinderung seien in allen Schweizer Opferhilfen unterrepräsentiert, obwohl sie überdurchschnittlich betroffen seien.
Frauen mit Behinderung werden nicht erreicht
Die Gründe dafür, darin sind sich die Beraterinnen einig, sind strukturell: Betroffene mit Behinderung werden nicht gezielt angesprochen. Zudem sind sie auf die Unterstützung ihres Umfelds angewiesen, um an Informationen zu kommen, besonders dann, wenn sie in Institutionen leben. Und auch das Beratungsangebot selbst ist nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Viele der Mitglieder von Autistinnen.ch wünschen sich etwa die Möglichkeit, schriftlich beraten zu werden, via Chat zum Beispiel.
Laut Rona Schilling von der Frauenberatung in Zürich besteht eine klassische Beratungssituation aus einem Vier-Augen-Gespräch, das 60 bis 90 Minuten dauert. Davon haben sie und ihre Kolleginnen vier pro Tag. Mit Vor- und Nachbereitung der Treffen sind sie ausgelastet. Eine Beratung von Betroffenen mit Behinderung bedeutet vor allem eines: Zusatzaufwand.
„Eine Klientin mit einer kognitiven Beeinträchtigung braucht eine sorgfältige und auf ihre Bedürfnisse angepasste Beratung. Einige brauchen mehr Pausen, wieder andere kommunikative Massnahmen wie Unterlagen in einfacher Sprache oder Piktogramme“, erklärt Schilling.
Bei Gewalt: Anspruch auf Schutz
Damit Menschen mit Behinderung richtig betreut werden können, braucht es mehr Zeit, besser ausgebildetes Personal und bedürfnisgerechte Kommunikation. Dafür braucht es Geld – vor allem vom zuständigen Kanton.
Silvia Vetsch vom Frauenhaus St. Gallen sagt: „Es muss für Frauen mit Behinderung klar sein, dass auch sie Schutzanspruch in einem Frauenhaus haben.“ Sie fordert mehr Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Informationskampagnen vom Bund. Parallel sieht sie die Kantone in der Pflicht, bestehende Barrieren abzubauen, indem sie die Frauenhäuser finanziell unterstützen.
Vetsch, die seit Jahrzehnten im Bereich Gewaltschutz arbeitet, ist überzeugt, dass die Betreuung der „komplizierten Fälle“ die neue Norm werden wird: Frauen, die von langjähriger häuslicher Gewalt betroffen sind. Frauen mit psychischen Einschränkungen sowie Frauen und Kinder mit Behinderung. Dafür seien die Frauenhäuser aktuell noch nicht überall gewappnet.
Sollten Sie oder Menschen in Ihrem Umfeld von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sein, ist das 24/7-Telefon der Opferhilfe Zürich unter der Nummer 044 455 2 142 rund um die Uhr erreichbar. Das Beratungsangebot ist anonym und kostenfrei. Wenn Sie hier klicken erreichen Sie den Notfall-Chat der Opferhilfe Luzern.
Text & Recherche: Janina Bauer
Redaktion: Hanna Fröhlich, Marc Engelhardt
Faktencheck: Sven Niederhäuser
Grafiken: Ivo Mayr, Janina Bauer
Kommunikation: Charlotte Liedtke